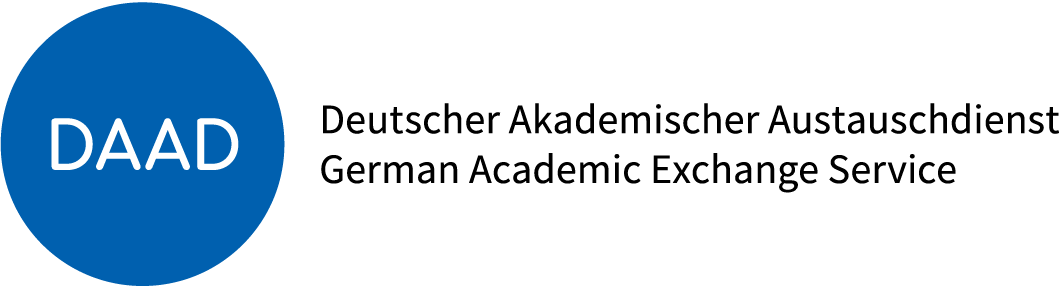PD Dr. Harald Tausch
Geb. 1965, Wiss. Ang. seit 2014, Habilitation 2006, #Gießen, Deutschland
Neuere deutsche Literaturwissenschaft (Fachgebiet) - Neuere dt. Literaturwissenschaft - Komparatistik (Lehrgebiet)
Kontaktinformationen:
Justus-Liebig-Univ. Gießen - FB 05 - Sprache, Literatur, Kultur - Otto-Behaghel-Str. 10 - 35394 Gießen
Monumenta Germaniae Historica, Ludwigstr. 16, 80539 München
Forschungsgebiete
- #Text und Bild, Multimedia
- #Historische Kulturwissenschaft
- #Historische Anthropologie
- #Empfindsamkeit, Sturm und Drang
- #Klassik
- #Romantik
- #Jahrhundertwende, Expressionismus, Neue Sachlichkeit
- #Literatur im 20./21. Jahrhundert, Exilliteratur, Literatur seit 1945
- #Editionen und Editionsphilologie
- #Gattungsgeschichte und Gattungstheorie
- #Produktions-, Rezeptions-, Wirkungsforschung
- #Hermeneutik und Literaturtheorie
- #Komparatistische Literaturforschung
- #Literatur und andere Künste
- #Poetik und Ästhetik
- #Stoffgeschichte, Motivgeschichte
- #Beziehungen zwischen Wissenschaften und Kunst
Besondere Forschungsgebiete Kunst, Wissen und Literatur im späten Kaiserreich, in der Weimarer Republik und der nationalsozialistischen Diktatur
Monographien
- Literatur um 1800. Klassisch-romantische Moderne. Berlin 2011
- "Die Architektur ist die Nachtseite der Kunst". Erdichtete Architekturen und Gärten in der deutschsprachigen Literatur zwischen Frühaufklärung und Romantik. Würzburg 2006
- Entfernung der Antike. Carl Ludwig Fernow im Kontext der Kunsttheorie um 1800. Tübingen 2000
Aufsätze und Beiträge
- Felix Hartlaub in Freudenstadt. Marbach am Neckar 2024 (= Spuren 135)
- Blaue Schatten. Goethe und Schopenhauer im Licht der italienischen Landschaft. In: Thomas Regehly (Hrsg.): Schopenhauer in Goethes Weimar. „Ob nicht Natur zuletzt sich doch ergründe …?“ Frankfurt a.M. 2023, S. 124-160
- Nächtliche Schatten in französischen Lithographien des 19. Jahrhunderts. In: Hühn, Helmut / Krieger, Verena (Hrsg.): Die Entdeckung der Nacht. Wirklichkeitsaneignungen im Prozess der europäischen Aufklärung. Weimar 2020, S. 243-264
- Kunstschriftsteller. Eine Begriffsgeschichte. In: Marchal, Stephanie / Degner, Andreas / Zeising, Andreas (Hrsg.): Kunstschriftstellerei – Konturen einer kunstkritischen Praxis. München 2020, S. 67-97
- Italien als Reflexionsraum für Felix Hartlaub. In: Herweg, Nikola / Tausch, Harald (Hrsg.): Das Werk von Felix Hartlaub. Einflüsse, Kontexte, Rezeption. Göttingen 2019 (= Marbacher Schriften neue Folge, Band 17), S. 32-49
- Die Stadt in E.T.A. Hoffmanns Nachtstück "Der Sandmann". Ein Beitrag zum Thema Recht und Literatur. In: Berghahn, Cord-Friedrich / Wiedemann, Conrad (Hrsg.): Berlin 1800. Deutsche Großstadtkultur in der klassischen Epoche. Hannover 2019 (= Berliner Klassik. Eine Großstadtkultur um 1800, Band 24), S. 307-326
- Kleist, Winckelmann und die Schweiz. In: Kahlau, Anja / Kunze, Max / Schade, Kathrin (Hrsg.): Winckelmann und die Schweiz. Petersberg 2018 (= Cyriacus. Studien zur Rezeption der Antike, Band 12), S. 125-138
- „wo Liebhaber und Künstler patriotisch kunstverständig zusammen gewirkt“. Wallraf – Goethe – Sulpiz Boisserée. In: Ketelsen, Thomas (Hrsg.): Wallrafs Erbe. Ausstellungskatalog Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud. Köln 2018, S. 210-219
- Félicie Hartlaubs Traumprotokolle aus dem Ersten Weltkrieg und die Beschäftigung mit dem Traum im Kreis ihrer Familie. In: Jahrbuch zur Kultur und Literatur der Weimarer Republik 18 (2017), S. 19-53
- Subversiver Humor als lakonische Antwort auf die Realität des absolut Bösen. Felix Hartlaubs Schreibverfahren im Dritten Reich. In: Hartung, Gerald / Kleinert, Markus (Hg.): Humor und Religiosität in der Moderne. Berlin 2017, S. 195-230
- Die Winckelmann-Rezeption der klassisch-romantischen Moderne. In: Disselkamp, Martin / Testa, Fausto (Hg.): Winckelmann-Handbuch: Leben, Werk, Wirkung. Stuttgart, Berlin 2017, S. 267-278
- "Der Vorzug der antiken Welt". Die Weimarer Ausgabe der Werke Winckelmanns. In: Bomski, Franziska / Seemann, Hellmut / Valk, Thorsten (Hrsg.): Die Erfindung des Klassischen. Winckelmann-Lektüren in Weimar. Göttingen 2017 (= Jahrbuch / Klassik Stiftung Weimar 2017), S. 93-115
- Palmyra in Wissenschaft und Literatur um 1800. Winckelmann, Herder, Hölderlin und Goethe. In: Germanisch-romanische Monatsschrift 2016, S. 269-293
- Die Ruinen von Palmyra bei Heinrich von Kleist. In: Heilbronner Kleist-Blätter, Bd. 28 (2016), S. 215-223
- Kleist, Kant und Zschokke. Eine Hypothese zur „Kant-Krise“ Kleists. In: Heilbronner Kleist-Blätter Bd. 26 (2014), S. 23-34
- Architektur als Antwort. Raabe und Fontane. In: Robert Krause, Evi Zemanek (Hg.): Text-Architekturen. Die Baukunst der Literatur. Berlin, Boston 2014, S. 148-196
- „Gibt es ein Leben außerhalb dieses Krankenhauses?“. Das amerikanische Hospital (2010). In: Birgfeld, Johannes / Schütz, Erhard (Hg.): Michael Kleeberg – eine Werksbegehung. München 2014, S. 279-295
- Architektur und Bild in Goethes Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre (1821). In: Beyer, Andreas / Simon, Ralf / Stierli, Martino (Hg.): Zwischen Architektur und literarischer Imagination. München 2013, S. 274-315
- „Langsames Aufleben der Farben“. Felix Hartlaubs Wanderung durch Oberitalien im Sommer 1931 [zus. mit Nikola Herweg]. In: Herweg, Nikola / Tausch, Harald (Hrsg.): Felix Hartlaub. Italienische Reise. Tagebuch einer Studienfahrt 1931. Berlin 2013, S. 89-103
- Klassizismus, Literaturtheorien des. In: Nünning, Ansgar (Hrsg.): Metzler-Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze - Personen - Grundbegriffe. Stuttgart [u.a.] 2013, S. 371-375
- Erinnerungen an das irdische Paradies. Persien und die Alchemie bei Paul Fleming und Adam Olearius. In: Arend, Stefanie / Sittig, Claudius (Hrsg.): Was ein Poete kan! Studien zum Werk von Paul Fleming (1609-1640). Berlin 2012, S. 369-407
- Der Garten in der deutschen Literatur. Eine literaturhistorische Skizze vom Mittelalter bis ins Jahr 2010. In: Schweizer, Stefan / Winter, Sascha (Hrsg.): Gartenkunst in Deutschland. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Geschichte - Themen - Perspektiven. Regensburg 2012, S. 405-427
- Der Garten als Heterotopie. Michael Kleebergs Roman "Ein Garten im Norden" (1998). In: Brüggemann, Heinz / Schneider, Sabine (Hrsg.): Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Formen und Funktionen von Pluralität in der ästhetischen Moderne München 2011, S. 275-293