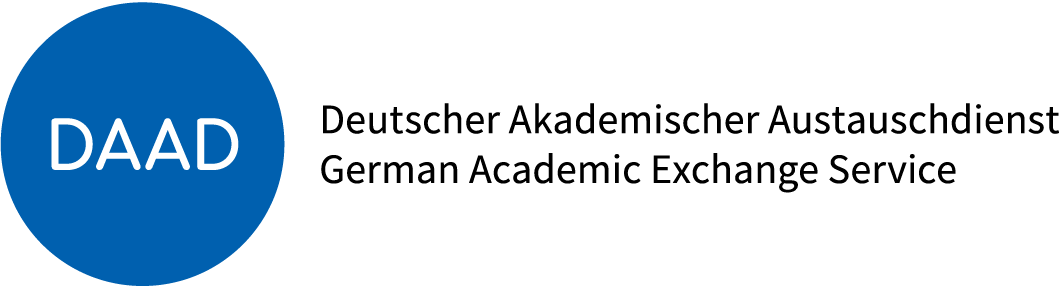Prof. Dr. Manuel Braun
Professur seit 2010, Habilitation 2007, #Stuttgart, Deutschland
Ältere deutsche Literaturwissenschaft (Fachgebiet) - Ältere dt. Literaturwissenschaft (Lehrgebiet)
Kontaktinformationen:
Universität Stuttgart - Institut für Literaturwissenschaft - Keplerstr. 17 - 70174 Stuttgart
https://www. ilw. uni-stuttgart. de/ institut/ team/ Braun-00032/
Forschungsgebiete
- #Historische Kulturwissenschaft
- #Historische Anthropologie
- #Hochmittelalter
- #Spätmittelalter
- #Frühe Neuzeit (Humanismus, Renaissance, Barock, Aufklärung)
- #Computerphilologie
- #Editionen und Editionsphilologie
- #Poetik und Ästhetik
- #Gebrauchs-/Gelegenheitsliteratur
Besondere Forschungsgebiete
- #Lyrik des Mittelalters
- Editorik
- Literarästhetik
- #Digital Humanities
Monographien Ehe, Liebe, Freundschaft. Semantik der Vergesellschaftung im frühneuhochdeutschen Prosaroman. Tübingen 2001.
Aufsätze und Beiträge
- Begrenzte Reichweite. Tendenzen zur Vereindeutigung im "Nibelungenlied" *C. In: Beiträge zur mediävistischen Erzählforschung 6, 2023, S. 1-22, https:/
- "schelten, singen, smeichen". Kommunikationsverben als Schlüssel zum Selbstverständnis des Sangspruchs. In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 69, 2022, S. 5-23
- Geschichte(n) des Minnesangs. In: Beate Kellner u.a. (Hrsg.): Handbuch Minnesang. Berlin, Boston 2021, S. 465-506.
- Heile(nde) Leiber, verwundete Herzen. Zu Darstellung und Funktion männlicher Verletzlichkeit im Artusroman und im Minnesang. In: Cécile Lignereux u.a. (Hrsg.): Vulnerabilität / La vulnérabilité. Diskurse und Vorstellungen vom Frühmittelalter bis ins 18. Jahrhundert / Discours et représentations du Moyen-Âge aux siècles classiques. Tübingen 2020, S. 327-353.
- Zur Gattungsgebundenheit lyrischer Selbstbezüglichkeit. Minnesang und Sangspruch des 13. Jahrhunderts im Vergleich. In: Dorothea Klein (Hrsg.): Formen der Selbstthematisierung in der vormodernen Lyrik. Hildesheim 2020, S. 101-134.
- Kunst. In: Dorothea Klein u.a. (Hrsg.): Sangspruch / Spruchsang. Ein Handbuch. Berlin, Boston 2019, S. 260-284.
- [mit Nora Ketschik\ Soziale Netzwerkanalysen zum mittelhochdeutschen Artusroman oder: Vorgreiflicher Versuch, Märchenhaftigkeit des Erzählens zu messen. In: Das Mittelalter 24 (2019), S. 54-70.
- [mit Annette Gerok-Reiter\: Selbstbezüglichkeit und ästhetische Reflexionsfigur als Bausteine einer historischen Literarästhetik. Einige grundsätzliche Überlegungen aus Sicht der germanistischen Mediävistik. In: Annette Gerok-Reiter u.a. (Hrsg.): Ästhetische Reflexionsfiguren in der Vormoderne. Heidelberg 2019, S. 35-66
- [mit Nils Reiter\ Prologe statistisch. Zur Ergänzung qualitativer Zugänge zur Poetologie der mittelhochdeutschen Literatur durch quantitative. In: LiLi 48 / 1 (2018), S. 83–103. (DOI: 10.1007/s41244-017-0081-3).
- [mit Nils Reiter\ Sangsprüche auf/in Wörterwolken oder: Vorläufige Versuche zur Verbindung quantitativer und qualitativer Methoden bei der Erforschung mittelhochdeutscher Lyrik. In: JOWG 21 (2016/2017), S. 5–20.
- „Anfänge bedingter Art“. Zur Entstehung der mittelhochdeutschen Ich-Erzählung aus der lyrischen Ich-Rede. In: Sonja Glauch, Katharina Philipowski (Hrsg.): Von sich selbst erzählen. Historische Dimensionen des Ich-Erzählens. Heidelberg 2017, S. 159–203.
- [mit Sonja Glauch, Florian Kragl\ Grenzen der Überlieferungsnähe. Aus der Werkstatt der Online-Edition „Lyrik des deutschen Mittelalters“ (LDM). In: Dorothea Klein (Hrsg.): Überlieferungsgeschichte interdisziplinär. Neue Perspektiven auf ein germanistisches Forschungsparadigma. Wiesbaden 2016, S. 401–423.
- Der Glaube an Heroen und Minnende als ‚Glaube der anderen‘. Zugleich ein Beitrag zur mediävistischen Fiktionalitätsdiskussion. In: Silvan Wagner (Hrsg.): Interpassives Mittelalter? Interpassivität in mediävistischer Diskussion. Frankfurt a. M. u.a. 2015, S. 83–111.
- grüezen statt bîligen. Verbale Tabus im Minnesang. In: Alexander Dingeldein, Matthias Emrich (Hrsg.): Texte und Tabu. Zur Kultur von Verbot und Übertretung von der Spätantike bis zur Gegenwart. Bielefeld 2015, S. 19–40.
- Verdeckte Voraussetzungen oder: Versuch über die Grenzen der Hermeneutik. Einige Vorüberlegungen zur Erfassung ‚literarischer Säkularisierung‘. In: Susanne Köbele, Bruno Quast (Hrsg.): Literarische Säkularisierung im Mittelalter. Berlin 2014, S. 409–425.
- Alterität als germanistisch-mediävistische Kategorie: Kritik und Korrektiv. In: Manuel Braun (Hrsg.): Wie anders war das Mittelalter? Fragen an das Konzept der Alterität. Göttingen 2013, S. 7–38.
- Lebenskunst oder: Namen als biographische Referenzen bei Oswald von Wolkenstein. In: JOWG 19 (2012/2013), S. 137–162.
- Aufmerksamkeitsverschiebung. Zum Minnesang des 13. Jahrhunderts als Form- und Klangkunst. In: Wolfram-Studien 21 (2013), S. 203–230.
- Die Künstlichkeit des dialogischen Liedes. In: Marina Münkler (Hrsg.): Aspekte einer Sprache der Liebe. Formen des Dialogischen im Minnesang. Bern u.a. 2011, S. 19–34.
- Epische Lyrik, lyrische Epik – Wolframs von Eschenbach Werk in transgenerischer Perspektive. In: Hartmut Bleumer, Caroline Emmelius (Hrsg.): Lyrische Narrationen – narrative Lyrik. Gattungsinterferenzen in der mittelalterlichen Literatur. Berlin, New York 2011, S. 271–308.